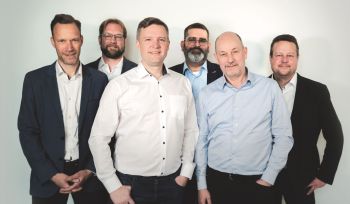Der günstige Einkauf im benachbarten Ausland gehört heute bei nicht wenigen Schweizern zum Alltag. Auswirkungen davon lassen sich in der nach wie vor heftigen Diskussion beispielsweise um Lebensmittel- und Arzneimittelpreise ablesen. Zuletzt hatte 2012 die für Schweizer Verhältnisse rekordhohe Busse von 156 Millionen Franken gegen BMW dem Thema neuen Auftrieb gegeben. Dabei erscheint die Situation auf den ersten Blick recht einfach: Wenn Autos oder eben Computer im Nachbarland günstiger sind, spricht kaum etwas dagegen, von diesen tiefen Preisen zu profitieren. Kein Wunder also, dass immer wieder und ziemlich hartnäckig vorgerechnet wird, wie viel billiger die Schweizer einkaufen könnten, wenn hierzulande Parallelimporte zugelassen wären.
Dabei ist die Einfuhr von Waren von einem Niedrigpreis- in ein Hochpreisland innerhalb der europäischen Freihandelszone inklusive der Schweiz schon seit 1972 erlaubt. Wobei die Bedingungen dafür seither sukzessive und bis in die jüngste Vergangenheit weiter liberalisiert worden sind (siehe Kasten S. 28). Laut dem grössten Schweizer Wirtschaftsverband, Economiesuisse, sind derartige Einfuhren von den hiesigen Unternehmen akzeptiert.
Allerdings ist bis heute unklar, was beispielweise das 2009 revidierte Patentgesetz als einer der letzten Liberalisierungsschritte bei Parallelimporten real gebracht hat. Eine entsprechende Interpellation der SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo beantwortete der Bundesrat im letzten November mit dem Rückgriff auf Studien aus dem Jahr 2000. Dort war das infrage kommende Marktvolumen auf rund 7,3 Milliarden Franken oder etwa 5 Prozent der Gesamtimporte geschätzt worden. Der maximal zu erwartende volkswirtschaftliche Effekt der Zulassung von Parallelimporten patentgeschützter Güter aus der ganzen Welt ist darin mit 0 bis 0,1 Prozent des Bruttoinlandproduktes angegeben. Insgesamt, so schrieb der Bundesrat 2012, sei «es kaum möglich, den volkswirtschaftlichen Nutzen der am 1. Juli 2009 in Kraft getretenen Liberalisierung des Parallelimportregimes zu beziffern».
Der Hüter des Wettbewerbs hat Zähne
Da konkrete Zahlen fehlen, können immer nur selektiv einzelne Produktpreise verglichen werden. Denn selbst wenn die Studie vom Jahr 2000 Preissenkungen beispielsweise in der Unterhaltungselektronik und bei Computern beobachtet, lässt sich laut Bundesrat heute «kaum ermitteln», inwiefern «diese die Folge des neuen Parallelimportregimes, des raschen technischen Fortschritts oder des spielenden Wettbewerbs sind». Gleichwohl fokussiert die Zulassung von Parallelimporten weiterhin klar darauf, den Konsumenten günstigere Preise zu bescheren und Konkurrenz in die offiziellen Vertriebswege zu bringen.
Dafür, dass das gelingt, sorgen hierzulande die Kartell-Hüter der Wettbewerbskommission (Weko). BMW hatten sie nachweisen können, unerlaubte Gebietsabsprachen getroffen zu haben, was 2012 drastische Sanktionen zur Folge hatte. Bei Missbrauch kann die Weko bei den betroffenen Hersteller oder Händler bis zu 10 Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes einziehen (siehe Interview S.29). Nur wegen seiner Kooperationsbereitschaft blieb die Weko bei der Strafe für den Verband der CD-Produzenten in der Schweiz, der letztes Jahr 3,5 Millionen Franken bezahlen musste, weit unter dieser Höchststrafe. Beanstandet wurden hier ebenfalls Gebietsabsprachen unter Konkurrenten.
Hatte doch der Schweizer Ableger der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) seine Mitglieder - unter anderem EMI Schweiz, Sony Schweiz, Universal oder Warner - seit 1999 Erklärungen unterschreiben lassen, mit denen man sich verpflichtete, auf Parallelimporte von Produkten anderer IFPI-Mitglieder in die Schweiz zu verzichten. Dieses de facto Importverbot soll auch real durchgesetzt worden sein. Da zu der Busse noch erhebliche Aufwendungen für die juristische Auseinandersetzung kamen, wurde der Verband empfindlich getroffen. Somit zeigen die beiden Fälle sehr deutlich, dass die Schweiz - trotz (oder wegen) der anhaltenden Diskussionen - nicht gewillt ist, bei der Durchsetzung von Parallelimporten ein bloss zahnloser Tiger zu sein.
IT-Hersteller gehen gegen Missbrauch vorGrundsätzlich hat auch die IT-Branche längst akzeptiert, dass das Ausnützen nationaler Preisunterschiede heute zum allgemeinen Wettbewerb gehört und in Europa wie der Schweiz unstrittig ist. Um Missbräuche zu verhindern, hat beispielweise Hewlett-Packard in Europa seit 2004 eigene Teams im Einsatz. Diese Brand Protection Teams bekämpfen insbesondere den sogenannten Graumarkt, indem sie Testkäufe bei den Händlern durchführen und bei Fachhandelspartnern die Endkundennachweise (Enduser Verification) kontrollieren. HP hatte in der Folge auch die Verträge und Konditionen mit seinen Distributoren und Händlern angepasst und vereinheitlicht, was von den Betroffenen damals durchaus kontrovers diskutiert wurde. Das Ziel war, faire Wettbewerbsbedingungen unter den Händlern zu schaffen und zugleich die Qualität der Produkte und der dazugehörige Services für Endkunden sicherzustellen.
HP als Teil des Ganzen
Für Pierre Bolle, Country Manager Indirect Business von HP Schweiz, sind diese Faktoren auch heute noch entscheidend für die saubere Abwicklung von Parallelimporten. Grau- und Schwarzmarkt-Ware entdecke man in der Regel aufgrund auffallend günstiger Preise. «Auch in der Schweiz können wir durch äusserst kompetitive Preise mit dem Ausland mithalten. Produkte, die mit Preisen angeboten werden, die den normalen Markt mit Nachlässen von 10 Prozent oder mehr unterbieten, kontrollieren wir deshalb», erklärt Bolle. Dabei würden auch die gängigen Bestpreis-Portale im In- und Ausland überprüft. Kleinere Preisschwankungen seien meist währungsbedingt und gingen nicht über eine Differenz um drei Prozent hinaus. Obwohl die Bedingungen des Herstellers schon lange bekannt sind, kommt es immer wieder zu Missbräuchen. Ein gefälschtes Produkt bereitet spätestens bei einem Supportfall oder einem Systemausfall Schwierigkeiten. Handelt es sich bei einem solchen Fall um ein gefälschtes Produkt, erlöschen jegliche Garantieansprüche. Dagegen sei der Graumarkt viel aktiver, in den nicht autorisierten Handelswegen könne man jährlich «viele» Fälle aufdecken, wie Bolle sagt, ohne aber eine konkrete Zahl äussern zu wollen.
«Unsere Systemintegratoren und Händler sind vertraglich verpflichtet, ausschliesslich bei autorisierten Quellen zu beschaffen. Der Warenfluss lässt sich anhand der Seriennummer sehr genau verfolgen», so Bolle. Der Händler geht ein Risiko ein, wenn er sich vermeintliche Preisvorteile über nicht autorisierte Quellen erschliessen will. Bei spezifischen Projekten kann HP Spezialpreise über sogenannte Order Processing Guidelines (OPG) ansetzen. Dieser Spezialpreis kommt einem dedizierten Endkunden zugute. Tauchen Waren aus diesen Chargen im offenen Markt auf, läuten bei Herstellern alle Alarmglocken. Distributoren, Händler und Systemintegratoren, die mit Geräten solch zweifelhafter Herkunft handeln, müssen mit extrem unangenehmen Konsequenzen rechnen. Im schlimmsten Fall stammen die Produkte sogar aus illegalen Quellen, wie zum Beispiel Hehlerware. Diesbezüglich bestehen nicht nur keine Garantieansprüche, sondern die Abnehmer laufen ausserdem Gefahr, zivilrechtlich belangt oder gar in eine strafrechtliche Untersuchung involviert zu werden.
In den meisten Fällen begnügt man sich aber damit, den entstandenen Schaden ersetzt zu bekommen. Im Extremfall könne HP einem Händler auch die Autorisierung entziehen, was dann an die Wurzeln der Existenz gehen kann. «Der Partner und dessen Endkunde hat beim Bezug über den autorisierten Kanal nicht nur die Gewähr der einwandfreien Abwicklung von Garantiefällen, sondern zudem die grösstmögliche Gewissheit, mit einem zuverlässigen und von uns geprüften Geschäftspartner zusammen zu arbeiten», ergänzt Bolle.
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser
Während die Hersteller vergleichsweise offen kommunizieren, ist der Handel verschwiegener. Immerhin erzählen hiesige Branchenkenner, dass Parallelimporte ganz legal immer wieder genutzt werden. Auch bei der Erläuterung der dubiosen Machenschaften im Schwarzmarkt möchte niemand seinen Namen in der Zeitung lesen. Gleichwohl lässt sich ein Beispiel für die Entstehung von Fälschungen nachzeichnen. Da die Hersteller oft mit grossen Produzenten in Asien zusammenarbeiten und auch dort für einzelne Komponenten Unterproduzenten beschäftigt werden, tauchten immer wieder einmal Einzelteile wie Festplatten eines Markenproduktes auf, die zwar sehr günstig sind, deren Seriennummern man aber nicht zuordnen kann. Werden solche Produkte entdeckt, entfallen alle üblichen Services des regulären Herstellers. So soll es vorgekommen sein, dass Serviceverträge beim Hersteller gekauft worden waren und der Kunde auch ein vierstündiges SLA für Festplatten abgeschlossen hatte. Bei einem Notfall stellte sich aber heraus, dass die Seriennummern der verbauten Geräte nicht zuzuordnen waren. Die vereinbarten und bezahlten Services konnten nicht beansprucht werden, und der Hersteller hätte damals ein offizielles Verfahren eröffnet, das sogar von Anwälten begleitet wurde.
Bewusst ein solches Risiko einzugehen können sich seriöse Händler nicht leisten, heisst es denn auch unisono in der Branche. Wer nur aus kommerziellen Gründen Produkte importiere und weiterverkaufe, gefährde die oft gerade in den Services begründeten Qualitäten, die in fast allen
Projekten entscheidend seien. Auf viel Verständnis stösst darum beispielsweise HP, das regelmässig die gesamte Lieferkette vom Produzenten über den Distributor und Systemintegrator bis hin zum Endkunden unter die Lupe nimmt – wobei die Kontrollen zum Teil auch verdeckt durchgeführt werden.
Namhafter Handel - weniger Missbrauch
Dennoch ist der Druck zum Umgehen der offiziellen Vertriebswege auf den Handel gewachsen, weil im Internet immer wieder extrem günstig Angebote lanciert werden. Weil diese Preise auch die Endkunden kennen, hat das oft zumindest unangenehme Kundengespräche zur Folge. Zwar wird unter Einbezug solcher Aspekte das Problem mit dem Grau- und Schwarzmarkt noch komplexer. Doch wird immer wieder beteuert, dass insbesondere namhafte Firmen - auch wenn sie Internetshops unterhalten - sich selbst kleinere Schummeleien nicht leisten können. Wer so in der Öffentlichkeit steht wie zum Beispiel der zur Migros gehörende Online-Händler Digitec oder das Coop-Unternehmen Microspot, wird sich nicht auf den Graumarkt einlassen.
So ist beispielsweise die Position von Also Schweiz zum Thema Parallelimport unmissverständlich. Harald Wojnowski, Head of Division Solutions, erklärt, dass Also als offizieller Partner von führenden Herstellern grundsätzlich keine Parallelimporte tätigt. «Nur in extrem seltenen Ausnahmefällen bei Lieferengpässen und immer in Absprache mit betroffenen Herstellern kann es vorkommen, dass wir einzelne Produkte über andere offizielle Hersteller-Distributoren beziehen», erläutert Wojnowski.
Bei Digitec kennt man die Problematik im Detail. Denn im Fall Nikon, der dazu führte, dass der Hersteller 2011 wegen Beschränkungen von Parallelimporten 12,5 Millionen Franken Busse zahlen musste, war Digitec kurzzeitig involviert. Die Weko lehnte es damals allerdings ab, ihre Untersuchung auf involvierte Händler auszudehnen und verzichtete somit auch auf mögliche Sanktionen.
Heute, erklärt Martin Walthert, Chief Marketing Officer bei Digitec, versuche man in erster Linie die vom Hersteller vorgesehenen Vertriebswege im Inland zu nutzen: «Parallelimporte lohnen sich dann, wenn die Preisunterschiede zwischen Ausland und Schweiz so gross sind, dass sich die zusätzlichen Aufwände und Kosten durch den Import rechtfertigen.» Aber auch Lieferengpässe in der Schweiz könnten ein Grund für den Import sein. Und wenn es für gewisse Produkte keinen Importeur in der Schweiz gebe, übernehme man diese Funktion.
Wie geläufig Parallelimporte in der Schweiz sind, will Walthert zwar nicht beantworten. Doch er stellt klar, dass sie «vom Gesetzgeber nicht nur erlaubt, sondern teilweise sogar erwünscht sind, um den Wettbewerb anzukurbeln». Die Risiken hielten sich dabei in Grenzen: «Unglücklich ist es dann, wenn in der Schweiz bezogene Ware gegenüber den Importgütern einen Mehrwert bietet, beispielsweise mehr Garantie.» Digitecs Erfahrungen reichten über ein Jahrzehnt zurück, und «wir pflegen und schätzen unsere Geschäftsbeziehungen», betont Walthert. Selbst wenn ein Produkt kaputt gehe, gäbe es heute kaum noch Probleme: «Bei Herstellern, welche eine europa- beziehungsweise weltweite Garantie anbieten, kann die Garantieabwicklung bequem in der Schweiz gemacht werden. Bei Herstellern welche die Garantie nur in einem bestimmten Land - dem Ursprungsland des Produktes - anbieten, übernehmen wir die Garantieabwicklung.»
Handel will so wenig Parallelimport wie nötig
Digitec steht mit diesen Einschätzungen nicht allein. Obwohl die Importe legal sind, erklärt allerdings Bernhard Gysi, Geschäftsführer von ARP Schweiz, «gibt es allenfalls herstellerabhängige Vereinbarungen, die einen Parallelimport erschweren». Doch erklärt auch er, dass zuerst immer eine Lösung mit der Schweizer Herstellervertretung gesucht wird, um den «Kunden ein attraktives Angebot mit Produkten aus dem Schweizer Channel machen zu können». Nur falls dies nicht möglich sei, ziehe man einen Parallelimport in Betracht. Der lohne sich darum nicht in jedem Fall. «Aber es gibt Produktsegmente oder Marken, bei denen Einsparungen realisierbar sind respektive bei denen ein Parallelimport aufgrund der Marktsituation fast unumgänglich ist», weiss Gysi. Guido Portmann, Leiter Einkauf IT bei Distributor Alltron, bestätigt, dass die Frage, ob sich Parallelimporte lohnen, «abhängig ist vom Leistungspaket, das der Schweizer Lieferant anbietet, und von der Service-Intensität des jeweiligen Produktes». Auch Alltron versuche in erster Linie mit Schweizer Lieferanten zu arbeiten. «Offeriert uns dieser keine wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen, sind wir gezwungen, uns weltweit umzuschauen. Ein weiterer Grund für die Beschaffung im Ausland entsteht, wenn wir Verfügbarkeitsengpässe überbrücken müssen», so Portmann.
Dass überhaupt parallel importiert wird, erklärt der hiesige ARP-Chef Gysi damit, dass so «die Konkurrenzfähigkeit im Markt sichergestellt werden kann». Risiken ginge man aber gleichwohl ein, weil die Transportkosten hoch sind und länderspezifische Versionen auf dem Markt sind, die vom Stromkabel bis zur Betriebsanleitung nicht kompatibel sind mit der Schweiz. Und auch er erwähnt den «gegebenenfalls erschwerten Zugang zu Garantieleistungen». ARP ziehe deshalb nur dann Parallelimport in Betracht, wenn diese Punkte sichergestellt sind. Weil «Kundenzufriedenheit oberste Priorität geniesst», werde in Fällen, bei denen dieser Aspekt nicht gewährleistet ist, versucht, eine Lösung mit den Herstellern in der Schweiz zu erreichen.
Portmann von Alltron ergänzt, dass häufig im Ausland auch höhere Mengen abzunehmen sind, damit ein Geschäft zustande kommt. «Ferner kann die Schweizer Herstellerniederlassung Parallelimporten mit Preisreduktionen und Cashback-Aktionen begegnen», fügt er an. Ansonsten seien die Risiken, «eine professionelle Serviceorganisation vorausgesetzt», beim Parallelimport gering.
Für Gysi von ARP ist das Ziel denn auch der bestmögliche Preis in Bezug auf die Gesamtprozesskosten. Dies müsse nicht zwingend mit dem günstigsten Einkaufspreis übereinstimmen. «Da wir uns in den letzten Jahren immer stärker auf Geschäftskunden spezialisiert haben, versuchen wir all unsere Leistungen auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe zu optimieren». Ganz im Sinne dieser Philosophie ist für ihn klar, dass ARP keine Produkte im Ausland bezieht, wenn dadurch für die Kunden Nachteile bei der Garantie-Abwicklung entstehen. Und es wundert nicht, wenn Gysi anfügt, dass heute viele Händler in der Schweiz parallel importieren: «Jedoch werden dabei nicht immer die Bedürfnisse der Kunden in die Entscheidung mit einbezogen.»
Bei Alltron kennt man dieses Problem nicht, weil man über eine eigene Serviceorganisation verfügt, die diese Garantiefälle im Sinne der Kundenzufriedenheit lösen kann, wie Portmann erklärt. Vielmehr gelte es, «bei der Beschaffung für unsere Kunden möglichst gute Bedingungen mit dem ausländischen Lieferanten auszuhandeln», betont auch er. Im Vorteil sei man hier, weil Alltron kein Hersteller ist: «Als Distributor spielen wir nicht den Polizisten – wir setzen uns grundsätzlich für die Interessen der Kunden und des Handels ein.»
So wenig wie möglich
Auch wenn Portmann in Sachen Parallelimporte nicht für die ganze Branche sprechen will, so formuliert er doch den allgemeinen Trend: «Wir bei Alltron handeln nach dem Gebot ‹so wenig wie möglich›. Falls es nicht anders geht, haben wir die Infrastruktur und das Know-how dazu, dieses Instrument anzuwenden, um unseren Kunden wettbewerbsfähige Angebote zu offerieren.» Und ja, man kann es nicht vom Tisch wischen, es gibt Missbrauch, Grauimporte und den Schwarzmarkt. Doch alles in allem scheint die IT-Branche frühzeitig ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Es existieren Initiativen, um korruptes Verhalten in den Vertriebswegen auszuschalten. Dass dereinst der IT-Markt zur Insel der Seligen wird, muss deshalb gleichwohl niemand befürchten.
Parallelimporte
Für identische Produkte, die marken- oder urheberrechtlich vom Immateriellgüterrecht geschützt sind, können von Land zu Land unterschiedliche Preise bestehen. Wenn die Differenz gross genug ist, lädt sie zur Einfuhr aus dem Niedrig- in das Hochpreisland ein. Für diese Situation gibt es nicht nur einen Grund, immer spielen aber Währungsschwankungen, Kaufkraftdifferenzen und unterschiedliche Lebens- und Einkaufsmentalitäten eine Rolle. Allerdings sind in den globalisierten Märkten solche länderspezifischen Preisunterschiede als üblicher Wettbewerb akzeptiert. Darum sind solche Parallelimporte seit dem Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU von 1972 grundsätzlich innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) inklusive der Schweiz erlaubt. Mit der Erweiterung durch das Cassis-de-Dijon-Prinzip hat die Schweiz 2010 autonom nachvollzogen, dass aus einem Mitgliedstaat der EU stammende Produkte, die dort vorschriftsgemäss hergestellt wurden, überall in der EU und auch hier in Verkehr gesetzt werden dürfen. Einschränkungen sind nur aus übergeordneten öffentlichen Interessen zulässig.
Konkret wird bei solchen Produkteeinfuhren das real vorhandene Preisgefälle von Land zu Land kommerziell genutzt: Händler einer Hochpreisnation beschaffen sich Waren im Niedriglohnland, um sie daheim zu verkaufen. Damit treten sie in Konkurrenz zum Hersteller und seinem Vertriebsweg respektive anderen Händlern. Nur derart in ein Land eingeführte und vom Immateriellgüterrecht geschützte Produkte werden als Parallelimporte definiert. Sie haben nichts mit Re-, Grau- oder Schwarzimporten zu tun.
Kaum mehr Ausnahmen
Bis zum 1. Juli 2009 bestanden insbesondere bei Patentrechtsfragen noch diverse Ausnahmen. Seitdem sind aber auch die Parallelimporte von patentgeschützten Produkten - abgesehen von wenigen Ausnahmen wie etwa Arzneimittel - erlaubt. Zuvor konnte sich der Rechtsinhaber des Patents unter dem Vorbehalt des Missbrauchs gegen Parallelimporte zur Wehr setzen und entsprechende Verbotsrechte durchsetzen. Man sprach hier deshalb von nationaler und regionaler Erschöpfung. Die Neuregelung war politisch damals umstritten und wurde gegen die Empfehlung des Bundesrates beschlossen. Das Parlament hatte hier ebenfalls im Sinne der allgemein angestrebten Wirkung von Parallelimporten argumentiert und erwartet, dass sich aus der Zulassung patentgeschützter Güter aus der EU tiefere Preise für die Konsumenten ergeben. Heute gilt bei Parallelimporten von im EWR zugelassen Produkten das Prinzip der regionalen Erschöpfung. Demnach dürfen Produkte, die im EWR mit der Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gesetzt wurden, auch ohne dessen Zustimmung in die Schweiz importiert werden.