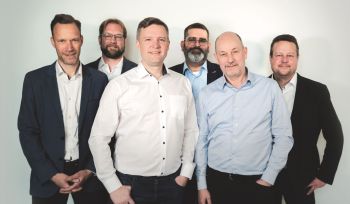Im letzten Jahr war, wie die Marktforscher von Gartner feststellten, nur gerade jedes zweite Unternehmen mit den Outsourcing-Ergebnissen zufrieden. Allein in Westeuropa sollen Projekte in der Höhe von sechs Milliarden Euro fehlgeschlagen sein.
Kunden in den angelsächsischen Ländern verpflichten ihre Berater daher immer öfter, die Konzepte selber umzusetzen. Der IT-Dienstleister
Accenture prägte dafür den Begriff «Business Innovation Partner» und meint damit, dass er Dienstleistungen erbringt, in die sich bisher Berater, Outsourcer, eigene Shared-Services-Töchter und Unternehmenseinheiten teilten.
Dazu werden Business Process Outsourcing (BPO)-Partnerschaften angeboten, bei denen sich Accenture am unternehmerischen Risiko beteiligt. «Partizipiert der Outsourcing-Partner am Erfolg», meint Georges H. Schmidt (Bild), Director Business Development Outsourcing bei Accenture Schweiz, «verbinden beide Parteien die gleichen Interessen.»
BPO sieht er vor allem als Lösung für Unternehmen, deren Flexibilität unter einer unverhältnismässig hohen Fertigungstiefe leidet. Laut einer Studie der Universität St. Gallen über das Outsourcing-Verhalten von Versicherungen sollen nämlich produzierende Branchen die Fertigungstiefe in den letzten Jahren oft auf bis zu 20 Prozent und weniger reduziert haben, während Versicherungen derzeit lediglich etwa ein Zehntel ihrer Aufgaben auslagerten.
Laut Schmid gilt ähnliches für öffentliche Verwaltungen, viele Finanzdienstleister und selbst für bestimmte Industriezweige.
Was gehört zum Kernbereich?
Selbstverständlich geht es nicht darum, Kernkompetenzen eines Unternehmens auszugliedern. Die Frage ist, was wirklich dem Core-Bereich zugerechnet werden muss und welche strategische Bedeutung die Unternehmen den Prozessen zusprechen.
Schmidt: «Nehmen wir beispielsweise ein Telekom-Unternehmen. Da gehören doch letztlich nur der Brand und allenfalls die Leitungen zum Kernbereich. Alles andere kann ebensogut ausgelagert werden.» Dem gegenüber hält die St. Galler Studie fest, dass die befragten Versicherer praktisch sämtliche Unternehmensprozesse als wichtig bzw. strategisch entscheidend einstufen.
Gleichzeitig zeigte die Befragung, dass «die Prozesslandschaften uneinheitlich sind, wenig Kostentransparenz existiert und kein regelmässiges Benchmarking durchgeführt wird». Diese Situation erschwert ein BPO ebenso wie die Angst, vom Sourcing-Partner abhängig zu werden.
Beteiligung an Risiko und Erfolg
«Andererseits», so Schmidt, «kann man aufgrund dieser Ergebnisse natürlich auch fragen, ob die Unternehmen wirklich so genau wissen, was ihre internen IT-Abteilungen tun. Ein sauber geregeltes BPO ist oft transparenter und die Verantwortlichkeiten sind klarer abgegrenzt als bei einer internen Lösung.» Und er erklärt: «Beim klassischen Outsourcing beruhen die Abmachungen auf Service Level Aggrements (SLA).
Das ist aber keineswegs der Weisheit letzter Schluss. Im Gegenteil: SLAs führen oft zu schlechter Stimmung, wenn der Vertrag zwar formal erfüllt wird, der Kunde aber trotzdem mit dem Ergebnis unzufrieden ist.»
Accenture versteht BPO daher als Partnerschaft: «Wir sind bereit, die Verantwortung für ganze Prozesse und deren Ergebnisse zu übernehmen und uns allein oder gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern am Risiko und am Erfolg zu beteiligen.» Als Beispiel für ein erfolgreiches BPO gilt ihm die Deutsche Bank, die ihren weltweiten Einkauf an
Accenture ausgelagert hat.
Unternehmerische Freiheit
Das Einbinden des Outsourcing-Partners in den Erfolg gibt diesem, wie Schmidt betont, auch mehr unternehmerische Freiheit, etwa für ein Off-Shoreing. «Natürlich können wir auf Wunsch des Partners unter Abwägung der finanziellen und anderer Interessen darauf verzichten. Aber grundsätzlich steht jedes global tätige Unternehmen in dieser Richtung unter Druck: Wenn es weltweit alle tun, kommt man selber kaum darum herum.»
Voraussetzung für ein erfolgreiches BPO ist, wie
Accenture betont, die Kostentransparenz der Geschäftsprozesse. Eine weitere Bedingung ist die Definition der Schnittstellen für eine effiziente Zusammenarbeit, wobei die Kontrolle über den Geschäftsprozess beim auslagernden Unternehmen bleiben soll. Vor allem aber muss der Effizienzgewinn grösser sein als die Kosten.
Das ist möglich, wenn der Dienstleister Skalenerträge erwirtschaften kann, indem er die Leistungen weiteren Unternehmen anbietet. Beim Beispiel Deutsche Bank etwa besorgt Accenture gleichzeitig auch die Beschaffung für vier weitere Institutionen.
Auch in der Schweiz?
Schmidt ist sicher, dass sich dieses Modell auch in der Schweiz durchsetzen wird und teilt die Visionen seines CEOs und Country Managers, Thomas Meyer, der sich durchaus vorstellen kann, dass es in der Schweiz nur noch einen einzigen Spezialisten gibt, der die Retailgeschäfte für sämtliche Banken abwickelt. Meyer: «Bei Coop können Sie ja auch Schokolade von fünf verschiedenen Herstellern kaufen.
Dafür brauchen sie nicht in fünf verschiedene Geschäfte zu gehen. Genauso kann ich mir vorstellen, dass nur noch wenige Banken das direkte Kundengeschäft betreiben und dabei mehrere Produkte anbieten. Ins Zentrum wird das Branding rücken. Eines Tages werden Sie eine Finanzleistung kaufen, auf der zwar nicht ‘Intel inside’, «wohl aber ‘Bank XY inside’ steht.» (fis)