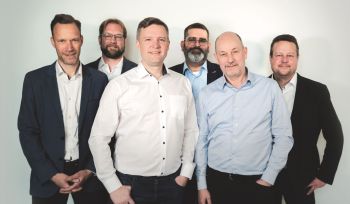«Woran erkennt man eine Schwulenhochzeit? ... Die Freunde heulen mehr als die Schwiegermutter.» So kalauerte das Lästermaul Harald Schmidt neulich am Fernsehen. Empfindsam, gefühlsbetont und nahe am Wasser gebaut: So ein paar gängige Vorurteile, die hinter vorgehaltener Hand bei Heteros über Schwule die Runde machen. Dass die sexuelle Ausprägung allein noch wenig über den Charakter eines Menschen aussagt, scheinen einige dabei völlig ausser Acht zu lassen.
Und trotzdem: Es gibt auch Lichtblicke. In vielen Branchen wird heute dank intensiver Aufklärung schon wesentlich offener mit dem Thema umgegangen, als noch vor ein paar Jahr-zehnten. In der Werbe- oder Modebranche beispielsweise haben sich in der Vergangenheit unzählige berühmte Persönlichkeiten offen zu ihrer Homosexualität bekannt und so den Weg für andere geebnet.
Allerdings: Was in gewissen Kreisen heute salonfähig geworden ist, sorgt in anderen Branchen auch heute noch für rote Köpfe. Dazu gehört auch die IT-Industrie, insbesondere der IT-Vertrieb.
Echte Kerle sind gesucht
Verkäufer müssen hartnäckig und willensstark sein, sich unter schwierigen Umständen durchsetzen und sich gegen die Konkurrenz behaupten können. Kurz: Gesucht werden hier noch echte Kerle. Sich hier als Schwuler zu outen, schaffen die wenigsten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Moël Volken, Geschäftsführer von Pink Cross, dem nationalen Dachverband der schwulen Männer in der Schweiz. Er meinte auf Anfrage zu diesem Thema: «In Bereichen, welche von klassisch männlichen Attributen wie beispielsweise Durchsetzungsvermögen und Aggressivität besetzt sind, ist ein Outing für die Betroffenen auch heute noch schwierig.»
Dauerstress am Arbeitsplatz
Viele verschweigen darum ihre Homosexualität am Arbeitsplatz und beginnen, ein regelrechtes Lügenkonstrukt aufzubauen. Sie mimen gegen aussen eine Person, die sie gar nicht sind. Das braucht Kraft und geht an die Substanz, wie diverse Untersuchungen der Vergangenheit aufgezeigt haben. Die Folge sind Schlafstörungen, Stress, Angstzustände und nicht selten Depression. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Daniel Räss in seiner Lizenziatsarbeit aus dem Jahr 2004 an der Universität Zürich. In seiner Studie kann man unter anderem nachlesen, dass sich 30% aller Schwulen, die ihre Homosexualität am Arbeitsplatz verheimlichen, latent gestresst fühlen. Im Gegensatz dazu, beträgt der Prozentsatz bei jenen, die das Outing schon hinter sich gebracht haben, gerade mal 16%.
Wie sollen homosexuelle Mitarbeiter, die in IT-Vertriebsfunktionen arbeiten, mit ihrer Homosexualität umgehen, und welche Möglichkeiten haben Firmen, ihre Angestellten auf dieses Thema zu sensibilisieren? Dazu die folgenden Erläuterungen:
Outing wichtig
Auch wenn es schwierig ist und sich dadurch vermeintliche Freunde von einem abwenden, ist Moël Volken überzeugt, dass in der Mehrzahl der Fälle ein Outing am Arbeitsplatz auf die Dauer unabdingbar ist. Nur so könne man sich vom unglaublichen Druck, der sonst auf einem laste, befreien. Volken weiter: «Wer sich hinstellt und sagt: Ich bin schwul!, zeigt damit echte Zivilcourage. Das macht Eindruck und die Reaktionen sind selbst in einem konservativen und eher schwulenfeindlichen Umfeld meist durchwegs positiv.» Ihm selbst sei beispielsweise das Outing eines Berufsmilitärs der Schweizer Armee bekannt, der dank einer offenen und klaren Kommunikation reihum viel Rückhalt und Lob bei Kollegen, Vorgesetzten und Untergebenen erhielt.
Verantwortung der Firmen
Obwohl schwulenfeindliches Verhalten in der Öffentlichkeit und der Geschäftswelt heute offiziell verpönt, ja sogar strafbar ist, sollte doch zu denken geben, wenn 80% der Schwulen und Lesben in Deutschland laut einer repräsentativen Umfrage des Kölner Psychologen Dominic Froh angeben, im Berufsleben Diskriminierung zu erfahren. Die Angst vor Ausgrenzung führt oft dazu, dass Schwule am Arbeitsplatz sich nicht als solche zu erkennen geben.
Insbesondere Branchen, die von Männern und männlichen Werten dominiert sind, wie zum Beispiel der IT-Vertrieb, sind auch heute noch für subtile Anfeindungen und Diskriminierung prädestiniert. Ähnlich wie im Sport, fällt es hier den Betroffenen doppelt schwer, sich zu outen. Denn auch hier gilt, was der Psychologe Chris Marcolli im Artikel des Beobachters (23/2004) zum Thema «Homosexualität im Fussball - Warten auf das Coming-Out» folgendermassen umschrieben hat: «Fussball ist für mich ein Machosport. Der Begriff schwul wird da als Schwäche angesehen.» Und weiter analysiert er: «Entweder kommt man mit der Situation gegen aussen souverän klar oder ein schwuler Spieler verlässt den Fussball.» Adaptiert auf den IT-Vertrieb bedeutet dies: Damit den betroffenen Mitarbeitern ihr Coming-Out am Arbeitsplatz erleichtert wird, müssen Firmen bestrebt sein, ein schwulenfreundlicheres Arbeitsklima zu schaffen. Und dies sehr wohl auch in ihrem eigenen Interesse. Denn Mitarbeiter, die angstfrei und offen arbeiten können, arbeiten auch besser.
Bereits heute findet hier bei vielen Grosskonzernen ein Umdenken statt. So verpflichten sich immer mehr Firmen auch in der Schweiz dem «Diversity-Gedanken». Die Idee dahinter: Der Respekt der Vielfalt nützt dem ganzen Unternehmen, weshalb es alle möglichen Formen der Diskriminierung zu bekämpfen gilt.
Dass die Unterzeichnung einer «Diversity-Charta», für Firmen durchaus auch wirtschaftliche Vorteile haben kann, bestätigt Albert Kehrer, Senior Manager Diversity and Inclusion bei
IBM Deutschland. In der «Welt Online» vom 17.6.2007 lässt er sich wie folgt zitieren: «Die IBM Diversity Policy kann ein Türöffner sein. Denn Homosexuelle kaufen bevorzugt bei Firmen, die das Etikett gay-friendly tragen.»
Ob Verkaufsleiter, Geschäftsführer, Channel Sales oder Account Manager: Sie alle haben das Ziel, einen guten Job zu machen. Geschlecht und sexuelle Präferenz sind für die Beurteilung der Leistung dabei völlig irrelevant, ja sogar diskriminierend. Für sie, wie für alle anderen Berufsgruppen gilt darum, was der Mediziner Rolf Stürm, Leiter der Fachgruppe Arbeitswelt, vor einiger Zeit treffend formulierte: «Man kann nicht schwul oder lesbisch arbeiten. Man kann nur gut oder schlecht arbeiten.»
Der Autor
Markus Schefer (40) ist selbständiger Personalberater. Daneben ist der ausgebildete Primarlehrer Dozent für das Fach «Verkauf» an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. Er verfügt über langjährige Vertriebserfahrung im In- und Ausland, unter anderem bei
IBM und Reuters.
www.scheferpersonal.ch
markus@scheferpersonal.ch