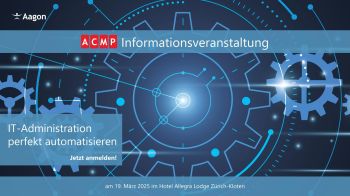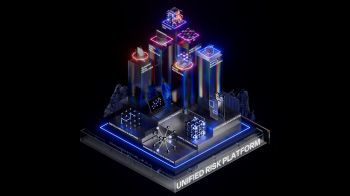Den Einstandspreis für einen Laib Brot zu berechnen, um danach einen Verkaufspreis zu fixieren, würde sich so mancher ohne weiteres zutrauen. Auch bei IT-Dienstleistungen ist die Rechnung vergleichsweise einfach. Die Kosten entstehen hauptsächlich im selben Land, wo auch die Dienstleistungen erbracht werden. Den Überblick zu behalten und einen sinnvollen Preis zu definieren, ist keine Hexerei.
Ungleich schwieriger präsentiert sich die Ausgangslage bei einem PC: Das Produkt setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelkomponenten zusammen und die Faktoren, die den Preis beeinflussen können, sind kaum überschaubar. Erschwerend kommen noch Währungsrisiken hinzu.
HP zum Beispiel gibt an, in 40 verschiedenen Währungen Geschäfte abzuwickeln. Mit dieser Ausgangslage eine erfolgreiche Preispolitik zu betreiben, ist eine Kunst.
Direkte und andere Einflüsse
Die Preise der Desktop-PCs und Notebooks von
HP werden monatlich fixiert. Dabei wird berücksichtigt, inwieweit sich die Kosten für die einzelnen Komponenten des Systems verändert haben. Der Preis wird in Dollar für ganz Europa zentral festgelegt. Das ist der Regelfall. Wenn es aber bei einzelnen Komponenten zu massiven Preisveränderungen kommt, interveniert HP schneller. «Eine solche Anpassung ist allerdings in den letzten fünf Jahren meines Wissens nur einmal vorgekommen», sagt Susanne Weber, die als Category und Marketing Managerin der Personal Systems Group von HP Schweiz tätig ist.
Es ist naheliegend, dass die Kosten der einzelnen Komponenten, die ein PC-System ausmachen, das grösste Gewicht bei der Preisbildung haben. Die Preise von Komponenten wie RAM, Prozessoren oder Festplatten hängen nicht nur von Angebot und Nachfrage ab. Sie werden auch vom Lebenszyklus der jeweiligen Technologie beeinflusst. Gut wird dieses zyklische Prinzip durch das Moorsche Gesetz illustriert, das besagt, dass sich die Anzahl Transistoren auf einem Mikroprozessor alle 18 Monate verdoppelt und dadurch ältere Chips unmittelbar günstiger werden. Weniger berechenbar sind bisweilen die RAM-Preise. Wie Weber festhält, waren die Kosten für die Komponenten alles in allem über die letzten Monate aber «stabil bis leicht abnehmend».
Der Markt macht’s
Der Endpreis gegenüber dem Kunden wird aber nicht nur durch die Komponenten beeinflusst, sondern auch durch die angepeilte Marge, die
HP erzielen will. Diesen direkten Einflüssen stehen die indirekten Faktoren gegenüber. Eine Rolle spielt hier beispielsweise, wie der Hersteller im jeweiligen Segment am Markt auftreten will. Beabsichtigt er als Preisbrecher aufzutreten, will er die Marktführerschaft oder die Technologieführerschaft übernehmen? Je nach Rollenverständnis gebärdet sich der Hersteller anders am Markt.
Bei HP werden die direkten und indirekten Faktoren für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zentral erfasst. Daraus wird dann der offizielle Listenpreis abgeleitet. Den einzelnen Länderniederlassungen bleibt aber hier noch ein Gestaltungsspielraum: «Lokal hat jedes Land die Möglichkeit, basierend auf den Marktgegebenheiten, Preisanpassungen auf den Schlüsselprodukten vorzunehmen. Daraus resultiert der lokale, empfohlene Strassenpreis», erklärt Susanne Weber.
Die Preise werden indes vor allem auch marktgerecht festgelegt. Will heissen, man schaut nach links und rechts, was die Konkurrenz so treibt. Oder man interveniert, wenn sich abzeichnet, dass ein Produkt zum Ladenhüter verkommt. Mit speziellen Promotionen versucht man dann die Produkte in den Markt zu drücken oder mit einem aggressiven Preis die Konkurrenten zu schlagen. Bei HP heisst dieses Instrument «Golden Offers».
Gezähmtes Risiko
Aufgrund all dieser Einflüsse und der Tatsache, dass
HP, wie eingangs erwähnt, mit 40 Währungen hantiert, könnten Wechselkursschwankungen zu einem grossen Unsicherheitsfaktor werden. Da es sich bei HP um ein Dollar-Unternehmen handelt, gilt es die Profitabilität in Dollars zu schützen, also den Dollar gegenüber den Fremdwährungen abzusichern. «Unsere Firmenphilosophie und -ethik schreibt vor, dass wir mit den Wechselkursen keine Spekulation betreiben», erklärt Kurt Brütsch (Bild), Finance Director bei der Schweizer Niederlassung von HP.
Die einzelnen Geschäftseinheiten in der Schweiz erstellen jeweils eine Prognose, welche Frankenumsätze sie in der nächsten Periode erwarten und mit welchem Betriebsaufwand sie rechnen. Diese Einschätzungen werden auf europäischer Ebene konsolidiert. Die Absicherung (Hedging) des Dollars gegenüber den Fremdwährungen erfolgt schliesslich zentral am Hauptsitz von HP in Paolo Alto von einem Spezialistenteam. Sie schliessen mit den Banken den Fremdwährungs-Vertrag ab, der den Wechselkurs für eine bestimmte Periode und das geplante Volumen fixiert. Kommt es in der anschliessenden Geschäftsperiode zu Schwankungen gegenüber diesem vereinbarten Kurs – ob negativ oder positiv –, hat dies keine Folgen auf die veranschlagte Marge des Unternehmens. Im Modell, das angewendet wird, sind die erzielten höheren Dollarumsätze (bei einem sich schwächenden Dollar) durch Fremdwährungsverluste aufgehoben. Auf längere Sicht gesehen werden aber für den Konzern die konsolidierten Dollarumsätze bei einem fallenden Dollar trotzdem eher positiv beeinflusst. Da die abzusichernden Volumen in der Fremdwährung jedoch als Prognosen geschätzt werden, steht die Firma dadurch manchmal auf der Gewinner- und ab und zu auf der Verliererseite. (map)